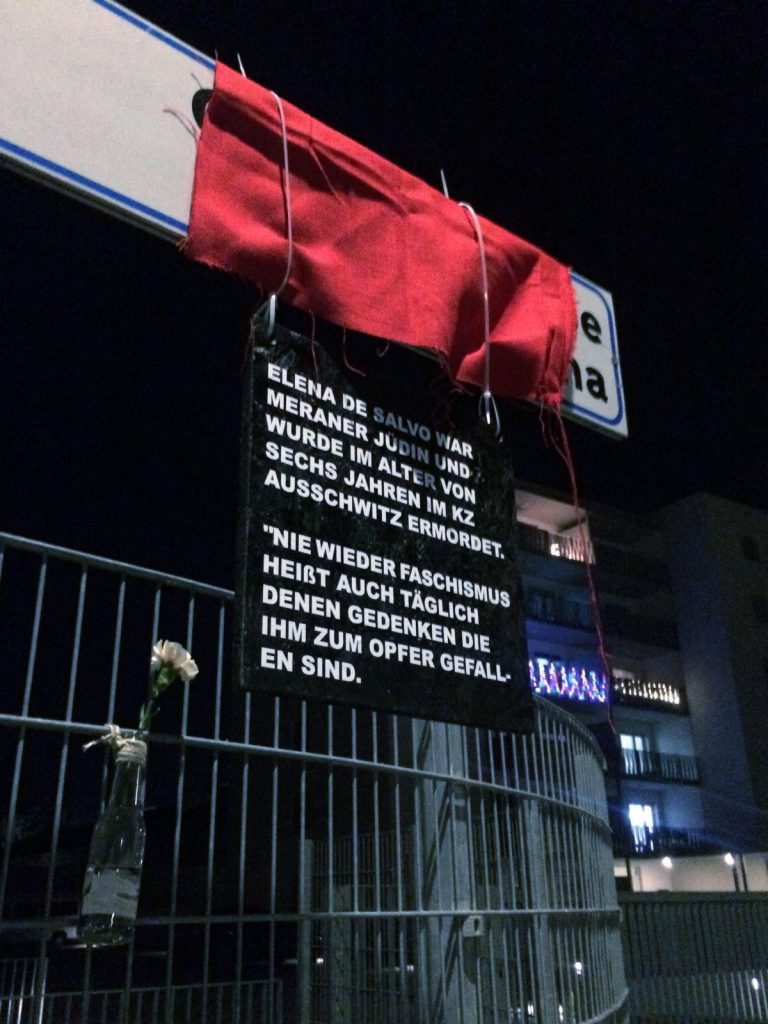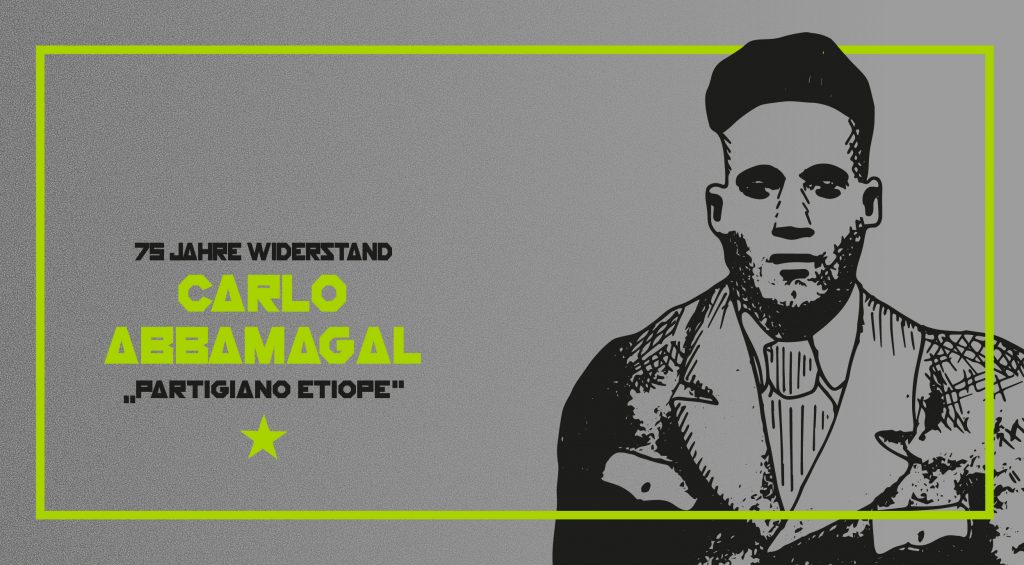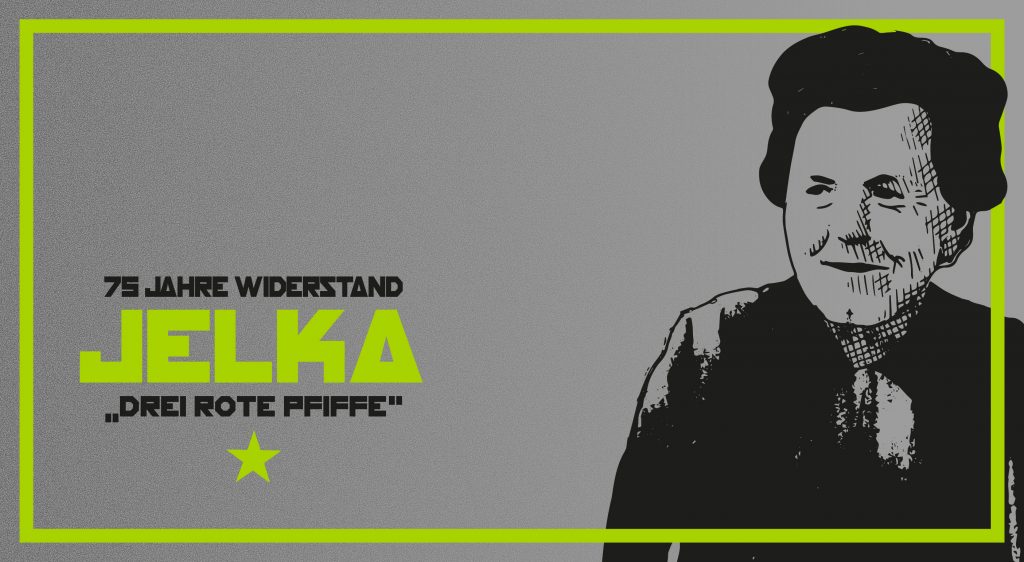warum südtiroler neonazis nach ostdeutschland pilgern, rechtsextreme gewalt nicht mit sonntagsreden zurückgedrängt werden kann und lina e. freigelassen werden muss.
warum südtiroler neonazis nach ostdeutschland pilgern, rechtsextreme gewalt nicht mit sonntagsreden zurückgedrängt werden kann und lina e. freigelassen werden muss.
ein toter nazi, schwerverletzte auf beiden seiten und eine polizei, die faschos schützt: bei der „höttinger saalschlacht“ sprengten linke gruppen in innsbruck in tirol eine propagandaveranstaltung der nsdap. der aufmarsch der nazis war eine provokation, ein muskelspiel der von den erfolgen in deutschland berauschten ns-bewegung. die antwort der linken war militant. damals, im mai 1932, eine straftat. die bürgerliche presse: empört. heute, nachdem 6 millionen jüdinnen und juden und weitere millionen menschen aus allen ländern der welt tot sind – vergast, erschossen, verschlissen im totalen krieg der „rassen“ – eine mutige aktion. vor dem hintergrund dessen, was sich abzeichnete, eine weitsichtige.
und es zeichnete sich deutlich ab: bereits 1925 hatte hitler seine politischen pläne detailliert in „mein kampf“ dargelegt: die vertreibung der jüd:innen aus der deutschen „volksgemeinschaft“; die eroberung osteuropäischer länder; die unterdrückung der opposition im „führerstaat“. alle wussten, was passieren würde, sollten die nazis an die macht kommen. leid, tot, krieg in europa. auch die liberalen und konservativen parteien wussten das. aber lieber ein paar getötete juden als die „roten“ in der regierung. zur zeit der „höttinger saalschlacht“ stand hitler kurz vor der machtergreifung: am 30. januar 1933 wird er mächtigster mann im deutschen reich. sofort beginnt er, seine pläne in die tat umzusetzen.
prellungen am rücken, platzwunden im gesicht
der mitteldeutsche rundfunk (mdr) zeigt die geprellten rücken und geschlagenen gesichter von drei männern. die bilder sind nicht leicht zu ertragen. lina e. und drei weiteren aktivisten aus thüringen wird deswegen der prozess gemacht. es geht um lange jahre im gefängnis. einige vorwürfe scheinen konstruiert, anderes mag sich so zugetragen haben. die betroffenen: neonazis. auch das thematisiert der mdr. was er nicht zeigt: die faschistische mobilmachung in ostdeutschland und die rolle, die die drei männer dabei spielen.
Weiterlesen →